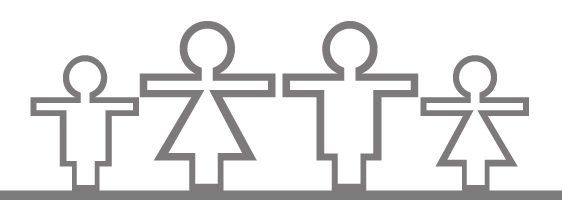01
Sprachstörungen

• Sprachentwicklungsstörung im Kindesalter• Sprachentwicklungsverzögerung im Kindesalter
„SPRACHENTWICKLUNGS-STÖRUNGEN (SES) SPRACHENTWICKLUNGS-VERZÖGERUNG (SEV) BEI KINDERN.“
Wenn ein Kind sprechen lernt, ist es völlig normal, dass das Kind nicht sofort alle Wort- und Satzkonstruktionen richtig bilden kann. Mit vier bis fünf Jahren sollte es jedoch die meisten grammatischen Strukturen korrekt bilden können. Auch eine Einschränkung des Wortschatzes bzw. des Sprachverständnisses können Hinweis auf eine Sprachentwicklungsverzögerung sein.
Auffälligkeiten im Bereich der Grammatik können z.B. Auslassungen der Vorsilbe „ge-“ („Ich habe lacht“), das falsche Beugen von Verben („Ich tun“), oder Auslassungen von Wörtern bzw. Umstellung von Sätzen sein („Mama lange Haare hat“).
Die Einschränkung des Wortschatzumfanges ist beispielsweise daran erkennbar, dass dem Kind zur Kommunikation notwendige Wörter wie Nomen (z.B. Hund, Auto), Verben (z. B. laufen, essen) oder Adjektive/Adverbien (z.B. schön, groß) fehlen und es häufig auf allgemeine Wörter wie "Dings", "machen" oder "so" zurückgreift. Oft haben die Kinder auch Probleme, Wörter in einen Zusammenhang zu bringen (z.B. Hund und Katze dem Begriff "Tier" zuzuordnen oder Augen, Mund und Nase dem Begriff "Gesicht").
Da eine Sprachentwicklungsverzögerung häufig ein erhöhtes Risiko für spätere Lernschwierigkeiten oder für eine Lese-Rechtschreibschwäche darstellt, ist es wichtig, möglichst früh mit einer logopädischen Therapie zu beginnen.
02
Sprechstörungen
• Störung des Redeflusses (Stottern, Poltern) bei Kindern und Erwachsenen• Störung der Lautbildung (Dyslalie)• Sprechstörung nach neurologischen Erkrankungen (Dysarthrie) z. B. Multiple Sklerose, Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose

„SPRECHSTÖRUNGEN BEI KINDERN“
Bei Kindern gibt es sehr verschiedene Sprechstörungen, die sich grob in zwei Gruppen unterteilen lassen:
Störungen in der Bildung von Lauten (Artikulationsstörungen, verbale Entwicklungsdyspraxie) und Redeflussstörungen (Stottern/Poltern).
Störungen der Lautbildung bei Kindern sind sehr verschieden und haben ganz unterschiedliche Ursachen.
Artikulationsstörungen und verbale Entwicklungsdyspraxien können im Verlauf der kindlichen Entwicklung auftreten. Es ist wichtig, diese Störungen rechtzeitig zu erkennen und diese vor der Einschulung zu überwinden, damit sie das Lesen- und Schreiben lernen nicht beeinträchtigen.
„ARTIKULATIONS-STÖRUNGEN“
Von einer Artikulationsstörung spricht man, wenn Laute fehlerhaft gebildet werden oder diese durch andere Laute ersetzt werden. Die bekannteste Form der Artikulationsstörungen ist der Sigmatismus bzw. das "Lispeln", bei dem die Zunge bei der Bildung des Lautes /s/ bzw. /z/ zwischen oder gegen die Zähne rutscht. Oftmals ist gleichzeitig eine schlaffe Mundmuskulatur/ Artikulationsmuskulatur zu beobachten.
„VERBALE ENTWICKLUNGSDYSPRAXIE“
Die verbale Entwicklungsdyspraxie wird als Störung sprechmotorischer Programmierungsprozesse definiert, d.h. der Betroffene weiß sehr genau was er sagen möchte, kann allerdings aufgrund der gestörten Handlungsplanung die motorischen Mund- und Zungenbewegungen nicht korrekt ausführen. Die Kinder strengen sich beim Sprechen sehr an, und es scheint, als ob sie die richtige Stellung von Lippen, Zunge usw. bei der Artikulation suchen.
Die Auffälligkeit bei der Entwicklungsdyspraxie liegt in der Artikulation; Laute werden fehlerhaft gebildet oder durch andere ersetzt wodurch die Aussprache oft undeutlich klingt und schwer verständlich ist. Darüber hinaus können folgende Symptome auftreten: Schwierigkeiten in der willkürlichen Sequenzierung von Sprechlauten (sog. Quatschwörter können nicht oder meist nur falsch nachgesprochen werden, Laute werden in ihrer Reihenfolge vertauscht), Veränderungen in der Sprechmelodie (unangemessene Betonung), Probleme im Saug-, Schluck- und Atemrhythmus, Bevorzugung von weichen und breiigen Nahrungsmitteln, Defizite in der oralen Wahrnehmung.
Mit der Therapie sollte so früh wie möglich begonnen werden, diese sollte über einen längeren Zeitraum mind. 2-3 Mal pro Woche stattfinden.
„STOTTERN“
Als Stottern bezeichnet man eine Störung des Redeflusses. Symptome sind Dehnungen, Blockierungen und Wiederholungen von Lauten, Silben oder einsilbigen Wörtern. Oft treten beim Stottern Begleitsymptome auf. Dies kann sich u.a. in körperlicher Anspannung, Mitbewegungen von Körperteilen, Vermeiden von gefürchteten Wörtern oder Sprechangst äußern.
Stottern äußert sich in Form von unfreiwilligen Wiederholungen von Lauten und Silben ("Babababall") sowie als Dehnungen ("Fffffisch") oder Blockierungen von Lauten (stummes Verharren vor oder in einem Wort, wobei Zeichen von Anstrengung sichtbar oder hörbar sein können: "---Tisch"). Diese Symptome werden Kernsymptomatik genannt, da sie das eigentliche Stottern darstellen. In Kernsymptomen verlieren stotternde Kinder für einen Moment die Kontrolle über den Sprechablauf, obwohl sie genau wissen, was sie in diesem Moment sagen wollen. Psychische Reaktionen wie Sprechangst, Wut oder Trauer über das Versagen beim Sprechen, Scham und Hilflosigkeit können hinzukommen. Die Lebensqualität kann durch psychische Reaktionen stark beeinträchtigt sein, selbst wenn die Kernsymptomatik nur gering ist.
Es ist wichtig, stotternde Kinder möglichst früh (ab dem 2. Lebensjahr) zu erkennen und bei Bedarf zu behandeln, damit eine Rückbildung unterstützt werden kann oder, wenn dies nicht gelingt, ein leichtes selbstbewusstes Stottern erarbeitet werden kann.
„POLTERN“
Poltern ist eine Störung des Redeflusses bei der schnelles, unrhythmisches und undeutliches Sprechen auftritt. Zusätzlich bestehen fast immer Formulierungsschwierigkeiten. Im Gegensatz zum Stottern verbessert sich die Symptomatik bei Konzentration und langsamerem Sprechen.
Bei Poltern ist die Verständlichkeit des Gesprochenen durch eine phasenweise überhöhte Sprechgeschwindigkeit mit Auslassungen und Verschmelzungen von Lauten, Silben oder Wörtern ("zum Beispiel" wird "Zeispiel") beeinträchtigt. Außerdem treten viele Satzabbrüche, Umformulierungen und Floskeln sowie stotterähnliche Redeunflüssigkeiten auf. Polternde Menschen können oft das eigene Sprechen schlecht beobachten - die Störung ist ihnen häufig nicht oder nur ansatzweise bewusst. Stottern und Poltern können auch zusammen auftreten.
Polternde Kinder und Erwachsene können in einer Therapie (bei ausreichender Motivation) lernen, das Poltern zu kontrollieren.
03
Stimmstörungen

• organische, funktionelle und psychische Stimmstörung (Dysphonie) bei Kindern und Erwachsenen
Termin vereinbaren04
Schluckstörungen
• Störung der Nahrungsaufnahme (Dysphagie) bei Kindern und Erwachsenen bei neurologischen Erkrankungen• Missbildung im Mund- und Rachenraum z.B. Lippen,- Kiefer, Gaumemspalten• nach Tumoroperationen im Mund- und Rachenraum • Zungenfehlfunktion (myofunktionelle Störung) bei Kindern

05
Hörstörungen

. bei Cochlea- Implantat. auditive Störung der Wahrnehmung und der Verarbeitung . eingeschränkte auditive Merkfähigkeit (führt oftmals zu Lese- und Rechtschreibproblemen)
Termin vereinbaren
Zentrale Hörstörung bezeichnet eine Einschränkung der Hörwahrnehmung bei einem normal funktionierenden Hörorgan; Es liegt keine Schädigung des Ohres oder Verminderung des peripheren Hörvermögens vor. Menschen mit dieser Störung haben Schwierigkeiten beim Zuhören, beim Verstehen und Verarbeiten von auditiven Informationen.
Anzeichen für eine zentrale Hörstörung können z.B. Überempfindlichkeit gegen Geräusche, eine verzögerte Sprachentwicklung mit undeutlicher Aussprache, Unsicherheiten beim Richtungshören, Defizite im Sprachverständnis und in der Merkfähigkeit, auditive Ablenkbarkeit sowie später Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, oder Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sein.
„PERIPHERE HÖRSTÖRUNG“
Eine periphere Hörstörung (Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit) wird durch eine Erkrankung des äußeren und/oder des Mittel- und/oder des Innenohrs verursacht. Mögliche Ursachen einer peripheren Hörstörung können u.a. häufige Mittelohrenentzündungen mit Paukenergüssen, Risse oder Vernarbungen im Trommelfell oder angeborene Innenohrschwerhörigkeit sein. Die Symptome sind oft ähnlich wie die einer zentralen Hörstörung. Je nach Schweregrad der Störung kann eine periphere Hörstörung durch hörverbessernde Operationen oder durch Hörgeräte so ausgeglichen werden, dass wieder eine möglichst normale Hörwahrnehmung zustande kommt. Oft ist Logopädie zur Korrektur der Artikulation und Aussprache, sowie zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmung notwendig.
06
LESE-RECHTSCHREIBSTÖRUNG (LRS) oder Legasthenie

Von einer LRS spricht man dann, wenn ein Kind erhebliche und andauernde Schwierigkeiten beim Erlernen von Lesen und Schreiben hat. Die betroffenen Personen haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen zur geschriebenen Sprache und umgekehrt. Es gibt keine „typische“ Fehlerart, die nur LRS-Kinder machen. Es sind meist die gleichen Fehler, die alle Kinder machen, nur dass sie sehr viel häufiger und länger anhaltend sind.Meist zeigen sich Schreibfehler in einer zu lautgetreuen Übertragung in die Schriftsprache: z.B. „schden“ statt „stehen“ oder „Fata“ statt „Vater“. Auch werden häufig ähnlich aussehende Buchstaben verwechselt wie „b“, „d“ und „p“.
Auslassen, Verdrehen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen, langsame Lesegeschwindigkeit, Verlieren der Zeile im Text, Vertauschen von Wörtern im Satz oder von Buchstaben in den Wörtern, Schwierigkeiten bei den Doppellauten genauso wie die Unfähigkeit, Gelesenes wiederzugeben, aus Gelesenem Schlüsse zu ziehen oder das Beantworten von Fragen zu Textinformationen sind häufig Anzeichen einer Leseschwäche.
Mehr erfahren
07
Sonderleistungen
Prävention und Beratung im Bereich der SprachentwicklungFür Eltern, die sich unsicher sind, ob sich die Sprache ihres Kindes altersgemäß entwickelt, bieten wir individuelle Beratungsgespräche an.
Prävention und Beratung im Bereich StimmeDiese Angebote richten sich vorwiegend an Menschen, die in typischen Sprechberufen wie Lehrer/-in, Erzieher/-in, Pfarrer/-in, Call-Center-Mitarbeiter/-in tätig sind:· Sie brauchen Ihre Stimme täglich,· Ihre Stimme ist ein wichtiges Arbeitsinstrument, ohne Ihre Stimme könnten Sie Ihren Beruf nicht ausüben.
Haben Sie bereits Stimmbeschwerden, z. B. rasche Stimmermüdung, Heiserkeit, Globusgefühl oder Räusperzwang, sollten Sie sich an einen Phoniater (Facharzt für Stimm-, Sprech- und Spracherkrankungen) oder an einen HNO-Arzt wenden. Diese können ggf. eine Stimmtherapie oder andere geeignete Maßnahmen einleiten, deren Behandlungskosten von den Krankenkassen getragen werden.
Termin vereinbaren